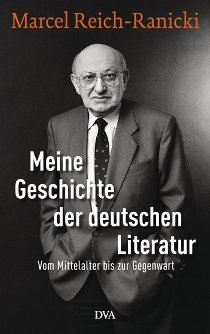|
||||||||||||||
Marcel Reich-Ranickis Literaturgeschichte
Einleitung: Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki und seine Literaturgeschichte
Von Thomas Anz
Das erste größere Buch, das Marcel Reich-Ranicki veröffentlicht hat,
erschien 1955 unter dem Namen Marceli Ranicki in Warschau. Es
blieb außerhalb Polens unbekannt, hat einen Umfang von 370 Seiten
und ist eine Geschichte der deutschen Literatur. Genauer: ihre
Geschichte ab der Reichsgründung im Jahre 1871 bis zur damaligen
Gegenwart. Der Titel: »Z dziejów literatury niemieckiej 1871–1954«,
zu Deutsch: »Aus der Geschichte der deutschen Literatur 1871–1954«.
Es beginnt mit Theodor Fontane und Gerhart Hauptmann, geht ausführlich
auf Thomas und Heinrich Mann ein, auf Lion Feuchtwanger,
Arnold Zweig und vor allem auf Anna Seghers, über die er 1957
sein zweites Buch veröffentlichte. In der Vorbemerkung erklärt der
Verfasser seinen polnischen Landsleuten: »Wenn dieses Buch neue
Liebhaber der deutschen Literatur gewinnt und dazu beiträgt, unsere
Verbindung zum friedliebenden und demokratischen Deutschland zu
vertiefen – so werde ich meine Aufgabe erfüllt haben.«
An der Aufgabe, andere zu dem zu machen, was er selbst war: zu
»Liebhabern der deutschen Literatur«, hat er bis zu seinem Lebensende
festgehalten. »Meine Geschichte der deutschen Literatur«, das
erste Buch Marcel Reich-Ranickis, das nach seinem Tod erscheint, ist
die bisher umfangreichste Auswahl aus den wichtigsten und besten
Essays dieses Kritikers. Sie ist in der Weise geordnet, dass sie ein Bild
jener deutschen Literaturgeschichte vermittelt, in der er seine Heimat
fand. Sie kann als Fortführung seines vor sechzig Jahren begonnenen
Vorhabens verstanden werden, aber auch als Gegenstück dazu. Denn
sie entstand unter ganz anderen Voraussetzungen, ist geschrieben in
anderer Form und richtet sich an ein anderes Publikum.
Als Kritiker eigener Bücher erinnert sich Reich-Ranicki in seiner
Autobiographie »Mein Leben« an die frühe Publikation nicht eben
begeistert: »Auf dieses Opus stolz zu sein, habe ich nicht den geringsten
Grund. Auch wenn manch ein Kapitel, manch ein Abschnitt mir
erträglich scheint, erröte ich nicht selten, wenn ich heute in diesem
Buch blättere.« Es sei »eine ziemlich schludrige Arbeit«, die allzu
deutlich erkennen lasse, »welche verheerende Doktrin auf den Autor
Einfluß ausgeübt hat – der sozialistische Realismus. Jawohl, meine
Literaturkritik war bis etwa 1955 von der marxistischen und gewiß
auch vulgärmarxistischen Literaturtheorie geprägt.« Als er 1951 als
Literaturkritiker zu schreiben begann, sei er außerdem Anfänger
gewesen. Und in Polen seien noch dazu seine Bemühungen, jene
Bücher zu bekommen, die nur im Westen verlegt wurden, zum Beispiel
die von Franz Kafka oder Robert Musil, vergeblich geblieben.
Alles, was in Reich-Ranickis jetzt vorliegender Geschichte der
deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu lesen ist,
hat er in den Jahrzehnten nach 1955 geschrieben, die Zusammenstellung
seiner Arbeiten dazu jedoch nicht mehr selbst vornehmen
können. Fragmentarisch bleibt seine neue Geschichte der deutschen
Literatur trotz oder gerade wegen ihrer erheblichen Erweiterung
immer noch, doch das kommt ihr durchaus zugute. Was jetzt zu lesen
ist, genügt nicht dem ohnehin problematischen Anspruch auf irgendeine
Vollständigkeit, mit der uns akademische Literaturgeschichten
so oft ermüden, sondern vermittelt ein Bild der ganz persönlichen
Vorlieben und Abneigungen eines Literaturkritikers, der diese in seiner
Literaturgeschichte mit großer Leiden- und Kennerschaft mitreißend
und oft provokativ zu begründen versucht. Allerdings gibt es
auch andere Gründe dafür, dass die Beiträge dieses Kritikers Lücken
in seiner Literaturgeschichte lassen – und zwar solche, die er selbst
gerne gefüllt hätte und die er mit verschiedenen Mitteln zumindest
in Ansätzen auszugleichen versuchte.
1958 reiste Reich-Ranicki in die Bundesrepublik, kehrte nicht mehr
nach Polen zurück und verschrieb sich ganz dem Beruf des Literaturkritikers.
Literaturkritiker haben anderes zu tun, als literaturgeschichtliche
Forschungen zu betreiben. Literaturkritik zeichnet
sich, seit es sie in unserem heutigen Sinn gibt, also seit dem frühen
18. Jahrhundert, dadurch aus, dass sie sich vorrangig der Gegenwart
zuwendet und sich von ihr herausfordern lässt. Im Gegensatz
zum gelehrten »Bücherwurm« und seiner pedantischen Anhäufung
von Wissen über eine ferne Vergangenheit sowie zum methodisch
geschulten Philologen, der sich vornehmlich um die gesicherte
Erkenntnis und Interpretation antiker Texte bemüht, entsteht in
Frankreich nach dem Vorbild des Juristen, Politikers und Philosophen
Michel de Montaigne, der als Begründer der Essayistik gilt, der neue
Typus des »weltmännischen« Kritikers. Dessen »critique mondaine«
richtet den Blick stärker auf die Gegenwart und die aktuelle Buchproduktion,
er schreibt nicht mehr in der lateinischen Sprache der
Gelehrten, sondern in der jeweiligen Volkssprache und wendet sich,
bevorzugt in Zeitschriften, an ein breiteres Publikum.
Dieser neue Typus des »Criticus«, aus dem der Literaturkritiker
im heutigen Verständnis hervorging, etabliert sich im Laufe des
18. Jahrhunderts. Das Prestige, das der Begriff »Kritik« im Zeitalter
der Auf klärung gewinnt, hat seine Arbeit motiviert und gefördert.
In der Tradition der Auf klärung war Marcel Reich-Ranicki ein
Kritiker mit Leib und Seele. Literarische Neuerscheinungen zu sichten
und zu sondieren, welche es verdienen, rezensiert zu werden,
von ihm selbst oder von seinen Mitarbeitern, das literarische Leben
der Gegenwart zu beobachten und an ihm teilzuhaben, stand im
Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Zahl seiner Veröffentlichungen zur
Literatur des 20. Jahrhunderts ist um ein Vielfaches größer als die
zur Literatur aller Jahrhunderte davor. Umso bemerkenswerter
bleibt es, dass er trotzdem die Geschichte der Literatur, vor allem
der deutschsprachigen, die Auseinandersetzung mit Autoren und
Autorinnen der Vergangenheit nie aus dem Auge verloren hat. Von
den Gelegenheiten, die auch gegenwartsorientierte Literaturkritiker
haben, sich mit der nahen und fernen Vergangenheit auseinanderzusetzen,
hat er ausgiebig Gebrauch gemacht: Gedenktage,
Preisverleihungen im Namen Büchners oder Hölderlins, Todesfälle,
die Veröffentlichung von Werkausgaben, Briefen oder Tagebüchern
längst toter Dichter.
Was haben sie ihm bedeutet? Spätestens bei der Lektüre von »Mein
Leben« konnte jeder begreifen, dass sein passionierter Umgang mit
der Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit einem existentiellen,
lebenserhaltenden und -intensivierenden Bedürfnis entsprach.
Er war Sohn einer deutschen Jüdin und eines polnischen Juden, die
jüdische Religion blieb ihm fremd, er wurde in Polen geboren, ging
in Berlin zur Schule, wurde 1938 von den Nationalsozialisten nach
Warschau deportiert, seine Eltern und sein Bruder wurden von
Deutschen ermordet, er lebte nach dem Krieg wenige Monate in
Berlin, beinahe zwei Jahre in London und dann wieder in Warschau,
wohnte nach seiner Ausreise aus Polen einige Jahre in Hamburg und
nach 1973 in Frankfurt. Für ihn konnte kein Ort auf dieser Welt zu
einer Heimat werden. Seine Heimat war die Literatur, vor allem die
deutsche. Sie war, mit dem von ihm oft zitierten Wort Heinrich Heines,
sein »portatives Vaterland«, eigentlich aber sein Mutterland. Die
Liebe zur deutschen Literatur und Kultur ist mit der Liebe zu seiner
Mutter Helene Reich, geborene Auerbach, unmittelbar verbunden.
Die Mutter beschaffte sich in Polen deutsche Bücher, abonnierte das
»Berliner Tageblatt«, zitierte in Gesprächen gerne die deutschen Klassiker,
und wenn der Sohn ihr zum Geburtstag gratulierte, machte
sie ihn regelmäßig darauf aufmerksam, dass sie am gleichen Tag wie
Goethe geboren sei.
Reich-Ranickis Veröffentlichungen zur Literatur sind Liebesbekundungen.
Noch seiner heftigsten Kritik ist die Enttäuschung
eines Liebhabers eingeschrieben, der nicht gefunden hat, was er leidenschaftlich
suchte: eine Literatur, die derart intelligent, fesselnd
und schön ist, dass man sie ein Leben lang lieben kann. Seine Literaturgeschichte
ist eine Liebesgeschichte, gekennzeichnet von oft
sehr persönlichen, höchst eigenwilligen Vorlieben, Abneigungen und
Ambivalenzen. »Nein, ich liebe ihn nicht, diesen Friedrich Hölderlin«,
beginnt einer seiner Essays, der diese Erklärung am Ende widerruft.
Bewunderung und Dankbarkeit empfinde er gegenüber diesem
Dichter, bekennt er, und fügt hinzu: »Wo ich mich vor der deutschen
Dichtung in Dankbarkeit und in Bewunderung verneige, da ist stets
auch sie im Spiel, die Liebe.«
[...]
Zur Haupt-Seite von Meine Geschichte der deutschen Literatur
Letzte Änderung an dieser Seite: 18.9.2014